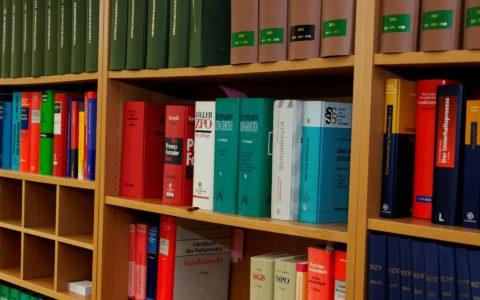Streiten der Hersteller eines im Inland zugelassenen Pflanzenschutzmittels A und ein Dritter, der für das von ihm importierte Pflanzenschutzmittel B die für das Produkt A bestehende Zulassung in Anspruch nimmt, über die chemische Identität der beiden Mittel, liegt die Darlegungs und Beweislast hierfür auch nach Inkrafttreten des § 16c PflSchG bei dem Dritten[1].

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 PflSchG dürfen Pflanzenschutzmittel in der Formulierung, in der die Abgabe an den Verwender vorgesehen ist, nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie vom Bundesamt zugelassen sind. Als zugelassen gilt nach § 11 Abs. 1 Satz 2 PflSchG auch ein Pflanzenschutzmittel, für das die Verkehrsfähigkeitsbescheinigung nach § 16c PflSchG festgestellt ist. Gemäß § 16c Abs. 1 Satz 1 PflSchG darf ein Pflanzenschutzmittel, das in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen ist und mit einem in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmittel übereinstimmt, nur eingeführt und in den Verkehr gebracht werden, wenn derjenige, der das Mittel einführen oder in Verkehr bringen will, zuvor beim Bundesamt die Feststellung der Verkehrsfähigkeit beantragt und das Bundesamt diese Feststellung getroffen hat. Die dabei vorausgesetzte Übereinstimmung des paralleleinzuführenden Pflanzenschutzmittels (Importmittel) mit dem entsprechenden zugelassenen Pflanzenschutzmittel (Referenzmittel) liegt, wie sich aus § 16c Abs. 2 Satz 1 PflSchG ergibt, dann vor, wenn das paralleleinzuführende Pflanzenschutzmittel die gleichen Wirkstoffe in vergleichbarer Menge mit entsprechendem Mindestreinheitsgrad und mit bestimmten Verunreinigungen gleicher Art sowie entsprechendem Höchstgehalt enthält wie das Referenzmittel (Nr. 1) und mit diesem in Zusammensetzung und Beschaffenheit übereinstimmt (Nr. 2).
Eine vergleichbare Menge des Wirkstoffs im Sinne des § 16c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PflSchG liegt gemäß § 1c Abs. 3 PflSchMGV (Verordnung über Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzgeräte – Pflanzenschutzmittelverordnung) vor, soweit sich der angegebene Wirkstoffgehalt des einzuführenden Mittels nicht von dem Wirkstoffgehalt des Referenzmittels unterscheidet (Nr. 1) oder bei der analytischen Bestimmung des Wirkstoffgehalts die in Anhang VI Teil C der Richtlinie 91/414/EWG unter der Nummer 2.7.2 Buchstabe a in der jeweils geltenden Fassung genannten Kriterien eingehalten wurden (Nr. 2). Nach § 1c Abs. 4 PflSchMGV ist eine Übereinstimmung in Zusammensetzung und Beschaffenheit im Sinne des § 16c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PflSchG gegeben, wenn beide Mittel in der Formulierungsart übereinstimmen (Nr. 1) und qualitative oder quantitative Unterschiede in den Beistoffen nicht zu Unterschieden im Hinblick auf die biologische Wirksamkeit, die Auswirkungen auf die zu behandelnden Pflanzen oder die Auswirkungen auf Mensch, Tier oder Naturhaushalt führen (Nr. 2). An einer solchen Übereinstimmung fehlt es nach § 1c Abs. 5 PflSchMGV insbesondere dann, wenn ein nicht bewerteter Beistoff oder eine nicht bewertete Beistoffsubstanz vorliegt (Nr. 1), Beistoffsubstanzen mit wesentlicher Funktion fehlen (Nr. 2), unterschiedliche Nominalkonzentrationen von Beistoffen mit wesentlicher Funktion vorliegen (Nr. 3), Beistoffsubstanzen vorliegen, die toxischer oder ökotoxischer sind als die des Referenzmittels oder die für die Wirksamkeit oder die Stabilität ungünstiger sind als die des Referenzmittels (Nr. 4), oder Beistoffe fehlen, die dem Anwenderschutz dienen oder zum Schutz Dritter Anwendung finden (Nr. 5).
Es liegt auf der Hand, dass in einem Vollstreckungsverfahren, dem ein den gestellten Unterlassungsanträgen entsprechender Verbotstitel zugrunde liegt, das Vollstreckungsgericht beurteilen müsste, ob ein Pflanzenschutzmittel in einer vom vorliegenden Streitfall abweichenden Zusammensetzung die Voraussetzungen der Verkehrsfähigkeit nach § 16c Abs. 2 PflSchG erfüllt. Dies könnte eine Würdigung der komplexen rechtlichen Begriffe des § 16c Abs. 2 PflSchG und des § 1c Abs. 3 bis 5 PflSchMGV im Vollstreckungsverfahren erfordern, die jedoch grundsätzlich dem Erkenntnisverfahren vorbehalten ist. Die vom Gläubiger im Vollstreckungsverfahren geltend gemachte Abweichung der Zusammensetzung des Importpflanzenschutzmittels vom Referenzmittel könnte völlig anders gelagert sein als diejenige, die Grundlage des vorliegenden Verfahrens ist. Das wäre – zumal unter Berücksichtigung dessen, dass die stoffliche Zusammensetzung des Referenzmittels für Außenstehende nicht ohne weiteres und im vollen Umfang erkennbar ist – nach der oben in Randnummer 16 angeführten Rechtsprechung nur dann hinzunehmen, wenn dies zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes im Hinblick auf das von der Klägerin beanstandete geschäftliche Verhalten der Beklagten erforderlich wäre. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Unlauterem Verhalten der Beklagten kann bereits durch ein konkreter gefasstes Verbot wirksam entgegengewirkt werden[2].
Die seit 14. Juni 2011 geltende und damit für die abschließende Beurteilung der in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanträge und der Folgeansprüche für den nachfolgenden Zeitraum möglicherweise ebenfalls maßgebliche Regelung des Parallelhandels mit Pflanzenschutzmitteln in Art. 52 der Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG ist mit der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelung in § 16c PflSchG vergleichbar. So kann gemäß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 1107/2009 ein Pflanzenschutzmittel, das in einem Mitgliedstaat (Ursprungsmitgliedstaat) zugelassen ist, in einen anderen Mitgliedstaat (nur) dann eingeführt und dort in Verkehr gebracht oder verwendet werden (Einfuhrmitgliedstaat), wenn dieser Mitgliedstaat feststellt, dass das Pflanzenschutzmittel in seiner Zusammensetzung mit einem Pflanzenschutzmittel identisch ist, das in seinem Gebiet bereits zugelassen ist (Referenzmittel). Pflanzenschutzmittel gelten nach Art. 52 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1107/2009 als identisch mit dem Referenzmittel, wenn sie von demselben Unternehmen oder einem angeschlossenen Unternehmen oder unter Lizenz nach demselben Verfahren hergestellt wurden, in Spezifikation und Gehalt an Wirkstoffen, Safenern und Synergisten sowie in Formulierungsart identisch sind und hinsichtlich der enthaltenen Beistoffe und der Größe, des Materials und der Form der Verpackung im Hinblick auf die potenziell nachteiligen Wirkungen auf die Sicherheit des Produkts in Bezug auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf die Umwelt identisch oder gleichwertig sind[3]. Pflanzenschutzmittel, für die vor dem 14.06.2011 Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen erteilt worden sind, dürfen noch bis zu dem Zeitpunkt in Verkehr gebracht werden, an dem die Zulassung des Referenzmittels endet, sofern nicht die Verkehrsfähigkeitsbescheinigung vor diesem Zeitpunkt durch Widerruf oder Rücknahme endet (vgl. § 5 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die vorläufige Durchführung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union über die Zulassung oder Genehmigung des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln[4]).
Die Zulassungsbestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes sind im Hinblick darauf, dass sie gemäß § 1 Abs. 4 PflSchG dem Schutz der Gesundheit der Verbraucher dienen, Marktverhaltensregelungen im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG[5]. Verstöße gegen diese Bestimmungen sind deshalb auch geeignet, die Interessen der Verbraucher nicht unerheblich bzw. spürbar im Sinne von § 3 UWG 2004, § 3 Abs. 1 UWG 2008 zu beeinträchtigen[6].
Der Anspruchsteller muss im Rahmen des in § 4 Nr. 11 UWG geregelten Rechtsbruchstatbestandes bei unter einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt stehenden Verhaltensweisen lediglich darlegen und im Bestreitensfall beweisen, dass das von ihm beanstandete Verhalten des Anspruchsgegners von dem generellen Verbot erfasst wird[7]. Aus diesem Grund hat im Streitfall die Beklagte darzulegen und zu beweisen, dass die von der Klägerin beanstandete Verhaltensweise von der Verkehrsfähigkeitsfeststellung gemäß § 16c PflSchG gedeckt ist.
Die in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung vertretene gegenteilige Ansicht[8] berücksichtigt nicht genügend, dass die in § 16c PflSchG enthaltene Regelung, die die Anforderungen an einen zulässigen Parallelimport verschärft hat, nicht nur bezweckt, die Rechtssicherheit für die Importeure hinsichtlich der Verkehrsfähigkeit ihrer Produkte zu erhöhen. Vielmehr soll sie insbesondere auch Rechtssicherheit für die Zulassungsinhaber und die Anwender schaffen sowie die Kontrolle der auf dem Markt befindlichen Pflanzenschutzmittel erleichtern, um sicherzustellen, dass keine Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht werden, die nicht bereits im europäischen Wirtschaftsraum zugelassen und mit einem in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmittel übereinstimmen[9]. Diese mit der gesetzlichen Neuregelung verfolgten Ziele gebieten es, dass bei einem Streit über die Identität der Mittel die Darlegungsund Beweislast bei demjenigen liegt, der für sich die Identität in Anspruch nimmt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 81/10 – Tribenuronmethyl
- Fortführung von BGH, Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 186/07, GRUR 2010, 160 Rn. 15 – Quizalofop[↩]
- vgl. für einen vergleichbaren Fall BGH, Urteil vom 06.10.2011 – I ZR 117/10, GRUR 2012, 407 Rn.19 und 21 bis 28 = WRP 2012, 456 – Delan[↩]
- vgl. Kamann, StoffR 2011, 52, 5355[↩]
- vom 23.05.2011 [BGBl. I S. 925]; Geesmann, StoffR 2011, 134, 139 f.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 10.02.2011 – I ZR 8/09, GRUR 2011, 842 Rn.20 = WRP 2011, 1144 – RC-Netzmittel; BGH, GRUR 2011, 843 Rn. 16 – Vorrichtung zur Schädlingsbekämpfung; BGH, GRUR 2012, 407 Rn. 31 – Delan[↩]
- vgl. BGH, GRUR 2011, 842 Rn. 21 – RCNetzmittel; GRUR 2011, 843 Rn. 16 – Vorrichtung zur Schädlingsbekämpfung; BGH, GRUR 2012, 407 Rn. 31 – Delan[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 23.06.2005 – I ZR 194/02, BGHZ 163, 265, 273 f. – Atemtest, zu § 21 AMG; BGH, Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 186/07, GRUR 2010, 160 Rn. 15 = WRP 2010, 250 – Quizalofop, zu § 11 PflSchG; Urteil vom 09.09.2010 – I ZR 107/09, GRUR 2011, 453 Rn. 21 = WRP 2011, 446 – Handlanger, zu § 21 AMG[↩]
- vgl. OLG Köln, GRUR-RR 2011, 113, 115; LG Aachen, Urteil vom 07.09.2010 – 41 O 110/09[↩]
- vgl. Begründung des Entwurfs der Fraktionen der CDU/CSU und SPD eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes, BT-Drucks. 16/645, S. 2 und 6[↩]