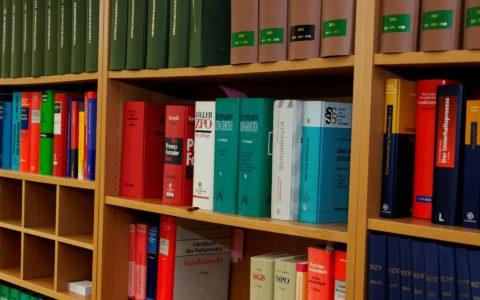In Fällen mit Auslandsberührung richtet sich die Rechtsscheinhaftung der Gesellschaft für das Handeln ihres Organs, das seine Vertretungsbefugnis bei einem Distanzgeschäft überschreitet, jedenfalls dann nach der an dem Ort der Abgabe der Willenserklärung geltenden Rechtsordnung, wenn diese zugleich über die organschaftliche Vertretungsmacht entscheidet[1].

Als maßgebliche Anknüpfung für eine Anscheinsvollmacht hat der Bundesgerichtshof den Ort angesehen, an dem der Rechtsschein entstanden ist und sich ausgewirkt hat, weil die Haftung allein auf dem Rechtsschein beruhe[2]; dabei ging es allerdings nicht um ein Distanzgeschäft, bei dem wie hier der Ort der Abgabe der Willenserklärung (hier: Brasilien) und der ihres Zugangs (hier: Deutschland) auseinanderfallen. Die gewählte Formulierung ist als unscharf kritisiert worden[3]. Im Ergebnis ähnlich stellen Teile der Literatur hinsichtlich der Rechtsscheinhaftung der Gesellschaft für das Handeln ihrer Organe auf das Recht des Ortes ab, an dem das Geschäft stattfand[4].
Andere plädieren für die Maßgeblichkeit des Vollmachtsstatuts. Der enge Zusammenhang zwischen Vertretungsbefugnis und Rechtsscheinhaftung erfordere die Anwendung derselben Rechtsordnung. Während dies bei einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht wegen ihrer Anknüpfung an den Gebrauchs- und Wirkungsort im Regelfall nicht zu anderen Ergebnissen führt, unterliegt die Rechtsscheinhaftung bei einer organschaftlichen Vertretungsmacht nach dieser Ansicht ohne Rücksicht auf den Handlungsort dem Gesellschaftsstatut[5].
Im Ergebnis führen alle Ansichten zu der Anwendung brasilianischen Rechts, es sei denn, man wollte den Ort des Zugangs der Willenserklärung als maßgeblich ansehen. Diese Auffassung wird nur vereinzelt vertreten[6]. Die überwiegende Meinung sieht wie das Berufungsgericht bei Distanzgeschäften stets den Ort der Abgabe der Erklärung des Vertreters als maßgeblich sowohl für die Anknüpfung einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht als auch der Rechtsscheinhaftung an[7].
Der Bundesgerichtshof hält die Anknüpfung an den Ort des Zugangs der Willenserklärung auch unter Vertrauensschutzgesichtspunkten jedenfalls dann nicht für richtig, wenn das an dem Handlungsort des Vertreters geltende Recht wie hier zugleich über dessen Vertretungsbefugnis entscheidet. An dieser Rechtsordnung muss sich der Geschäftspartner ausrichten, der auf die Vertretungsmacht einer im Ausland handelnden Person vertraut.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. Juli 2012 – V ZR 142/11
- Fortführung von BGHZ 43, 21 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 09.12.1964 VIII ZR 304/62, BGHZ 43, 21, 27; vgl. auch BGH, Urteil vom 05.02.2007 II ZR 84/05, NJW 2007, 1529, 1530 Rn. 9 mwN[↩]
- Leible, IPRax 1998, 257, 260; Heinz, Das Vollmachtsstatut [2011], S. 211 f.[↩]
- MünchKomm-BGB/Kindler, Int. GesR, 5. Aufl. Rn. 585; Staudinger/Großfeld, Int. GesR [1998] Rn. 285; Kaligin, DB 1985, 1449, 1452[↩]
- Hausmann in Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht, 6. Aufl., Rn. 2480; Heinz, aaO, S. 211 f.[↩]
- OLG Köln, IPRspr.1966/67 Nr. 25, S. 80 f.; Staudinger/Magnus, BGB [2010], Anh. II zu Art. 1 Rom IVO Rn. 39: Ort, an dem der Dritte vertraut[↩]
- LG Karlsruhe, RIW 2002, 153, 155; Erman/Hohloch, BGB, 13. Aufl., Anh. I nach Art. 12 EGBGB Rn. 7; Kropholler, IPR, 6. Aufl., S. 306, 308; Hausmann in Reithmann/Martiny, aaO, Rn. 2433, 2480; weitere Nachweise bei Heinz, aaO, S. 18, 162 ff.[↩]