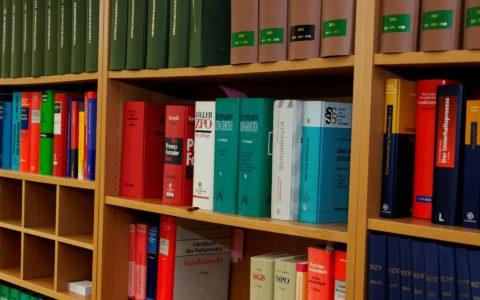Die Verjährung des Kaufpreisanspruchs aus einem dem UN-Kaufrechts-übereinkommen unterliegenden internationalen Warenkauf beurteilt sich nach dem nach dem Vertragsstatut zu bestimmenden unvereinheitlichten Recht, die Verwirkung von Ansprüchen dagegen nach dem Einheitsrecht des CISG.

Verjährung von Kaufpreisansprüchen
Die Frage einer Anspruchsverjährung wird, wie nicht zuletzt auch Art. 3 des Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf sowie zur Änderung des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19.05.1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) vom 05.07.1989[1] zeigt, nach nahezu einhelliger Auffassung mit Recht nicht zu den in Art. 4 Satz 1 CISG beschriebenen Regelungsmaterien des UNKaufrechtsübereinkommens gezählt[2]. Da weder Italien noch Deutschland zu den Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Verjährung beim internationalen Warenkauf vom 14.06.1974 gehören, bestimmt sich die Frage einer Verjährung gemäß Art. 32 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB aF nach dem Vertragsstatut und damit gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 EGBGB aF nach dem für den Sitz der Klägerin maßgeblichen unvereinheitlichten (hier: italienischen) Recht.
Verwirkung von Kaufpreisansprüchen
Die Frage einer Verwirkung beurteilt sich nicht nach unvereinheitlichtem Recht. Die im Kern auf den in Art. 7 Abs. 1 CISG benannten und in einer Reihe anderer Vorschriften für spezielle Fallgestaltungen konkretisierten Auslegungsgrundsatz der Wahrung des guten Glaubens im internationalen Handel zurückzuführende Frage einer Verwirkung von Rechtspositionen ist nach überwiegender und zutreffender Auffassung vielmehr im UNKaufrechtsübereinkommen mitgeregelt und deshalb gemäß Art. 7 Abs. 2 CISG anhand der dafür aus dem Übereinkommen herleitbaren Wertungen und allgemeinen Grundsätze zu entscheiden[3].
Bundesgerichtshof, Versäumnisurteil vom 23. Oktober 2013 – VIII ZR 423/12