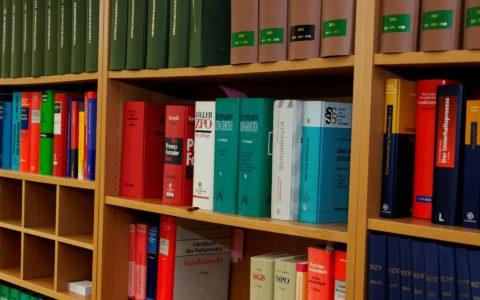Der Bundesgerichtshof hat dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zur Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 AEUV vorgelegt, ob Art 34. Nr. 4 EuGVVO[1] auch den Fall unvereinbarer Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat erfasst.

Anlass hierzu bot ein deutsch-rumänischer Fall: Ein rumänisches Unternehmen lieferte seinem deutschen Kunden Stahlprodukte. Wegen behaupteter Restforderungen aus dem Vertragsverhältnis reichte das rumänische Unternehmen eine Zahlungsklage in Rumänien ein, die von dem rumänischen Gericht rechtskräftig abgewiesen wurde. Kurz darauf leitete das rumänische Unternehmen erneut beim selben Gericht einen Rechtsstreit gegen ihren deutschen Kunden wegen desselben Streitgegenstandes ein und erwirkte nun ein zusprechendes Versäumnisurteil. Nachdem Rechtsmittel gegen dieses Urteil vor der rumänischen Gerichtsbarkeit keinen Erfolg hatten beantragte das rumänische Unternehmen nun die Vollstreckbarerklärung des Urteils in Deutschland.
Der Streitfall wirft die Frage auf, ob der Tatbestand des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO auch dann erfüllt ist, wenn die anzuerkennende oder für vollstreckbar zu erklärende Entscheidung mit einer Entscheidung aus demselben Mitgliedstaat kollidiert.
Die Unvereinbarkeit des klageabweisenden (ersten) Urteils und des klagestattgebenden (zweiten) Urteils ist im Streitfall zu bejahen. Die frühere rumänische Entscheidung ist im Inland anerkennungsfähig. Die Anerkennungsregelungen der EuGVVO sind in Rumänien am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (vgl. Art. 2 der Beitrittsakte[2]. Erst anschließend kann das erste Verfahren in Rumänien eingeleitet worden sein, weil die zugrunde liegenden Rechnungen im Jahre 2007 ausgestellt wurden. Nach Art. 66 Abs. 1 EuGVVO finden daher die Vorschriften der Verordnung auch auf die ältere Entscheidung vom 31.01.2008 Anwendung und es ist nicht ersichtlich, dass insoweit Versagungsgründe nach Art. 34, 35 EuGVVO eingreifen könnten.
Demnach wäre der jüngeren Entscheidung vom 06.03.2008 nach Art. 34 Nr. 4 EuGVVO die Vollstreckbarerklärung zu versagen, wenn die Vorschrift auch auf die Konstellation unvereinbarer Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat anzuwenden wäre.
Die Vorschrift wird in der Literatur unterschiedlich ausgelegt. Der Bundesgerichtshof neigt in Übereinstimmung mit dem Beschwerdegericht dazu, die Anwendbarkeit des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO bei kollidierenden Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat zu verneinen. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese nicht zweifelsfrei zu beantwortende Frage bislang – soweit ersichtlich – noch nicht entschieden.
Nach einer Meinung ergänzt die Vorschrift des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO den Versagungsgrund nach Nr. 3 und meint die Fälle, in denen nicht lediglich zwei Staaten – der Urteilsstaat und der Anerkennungsstaat – betroffen seien, sondern ein „Dreistaatenverhältnis“ vorliege, bei welchem der Anerkennungsstaat mit zwei in derselben Sache ergangenen unvereinbaren Entscheidungen aus zwei anderen Staaten konfrontiert wird[3]. Für diese Auffassung spricht insbesondere der Wortlaut der Vorschrift, die von einer Entscheidung aus einem „anderen“ Mitgliedstaat spricht, was einen vom Ursprungmitgliedstaat abweichenden Mitgliedstaat bezeichnen könnte.
Nach anderer Auffassung soll der Versagungsgrund indes auch eingreifen, wenn zwei unvereinbare Entscheidungen im selben Ursprungsstaat erlassen wurden und eine von ihnen nunmehr im Anerkennungsstaat für vollstreckbar erklärt werden soll[4]. Die Vorschrift sei zumindest analog auf diese Fälle anzuwenden[5]. Diese Auffassung stützt sich in erster Linie auf die Systematik und die Zielsetzung der Norm[6]: Während unter Art. 34 Nr. 3 EuGVVO nur die Fälle fallen, in denen die anzuerkennende Entscheidung mit einer Entscheidung des Anerkennungsstaates kollidiere, erfasse Art. 34 Nr. 4 EuGVVO die verbleibenden Kollisionsfälle von Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten. Bei einer anderen Auslegung verbliebe eine unbeabsichtigte Regelungslücke. Der Wortlaut „in einem anderen Mitgliedstaat“ könne auch als Abgrenzung zu dem in Nr. 3 genannten Anerkennungsstaat verstanden werden.
Bei der Auslegung der Norm wird zu berücksichtigen sein, dass die Formulierung des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO weiter als die Vorgängervorschrift des Art. 27 Nr. 5 EuGVÜ/LugÜ gefasst ist und sich nicht nur auf kollidierende Entscheidungen aus Nichtvertragsstaaten bezieht, sondern auch auf solche aus anderen Mitgliedstaaten. Das Ziel dieser Ergänzung des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO war es, frühere Lücken zu schließen[7]. Dennoch kann hieraus nicht zweifelsfrei geschlossen werden, dass der Verordnungsgeber damit auch unvereinbare Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat erfassen wollte. Denn es ist auch ein erklärtes Ziel der Verordnung, Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten ein besonderes Vertrauen entgegen zu bringen und die Versagung ihrer Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung auf Ausnahmefälle zu beschränken[8]. Dazu gehört auch das Vertrauen, schon die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten träfen Regelungen, in welcher Weise und unter welchen Voraussetzungen gegen dort ergangene unvereinbare Entscheidungen vorgegangen werden kann. Der Streitfall zeigt, dass es in Rumänien eine entsprechende Rechtsbehelfsmöglichkeit gibt, die allerdings aufgrund der Versäumung der hierfür vorgesehenen Monatsfrist durch die Antragsgegnerin erfolglos geblieben ist. Eine vergleichbare Regelung existiert in Deutschland gemäß § 580 Nr. 7 Buchst. a), § 586 Abs. 1 ZPO. Die Vorschrift des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO könnte daher bewusst auf Entscheidungen aus einem „anderen“ Mitgliedstaat im Sinne eines dritten Mitgliedstaates beschränkt worden sein, um den Umgang mit kollidierenden Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat der nationalen Rechtsordnung dieses Staates zu überlassen. Im Falle einer solchen engen Auslegung der Vorschrift würde der Versagungsgrund bei kollidierenden Entscheidungen aus demselben Mitgliedstaat ausscheiden.
Der Streitfall bietet keinen Anlass, der (zweiten) rumänischen Entscheidung aus anderen Gründen als nach Art. 34 Nr. 4 EuGVVO die Vollstreckbarerklärung zu versagen, weshalb es entscheidend auf die Beantwortung der Auslegungsfrage durch den Gerichtshof der Europäischen Union ankommt.
Der allgemeine Einwand eines Verstoßes gegen den ordrepublic nach Art. 34 Nr. 1 EuGVVO greift nicht durch. Der Versagungsgrund des Art. 34 Nr. 1 EuGVVO kann zwar im Falle eines Prozessbetrugs der Gläubigerin eingreifen[9]. Hierfür trägt die Antragsgegnerin jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte vor, was ihr aufgrund des in Deutschland geltenden Beibringungsgrundsatzes obläge[10].
Auch der Umstand, dass es zu kollidierenden Entscheidungen in einem Mitgliedstaat gekommen ist, reicht für sich allein nicht für eine Versagung der Vollstreckbarerklärung nach Art. 34 Nr. 1 EuGVVO aus. Die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen besteht auch in Deutschland. Es gibt zwar ebenso wie in Rumänien die Möglichkeit, mit einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 7 Buchst. a)) der deutschen Zivilprozessordnung gegen die widersprechende jüngere Entscheidung vorzugehen. Dennoch kann es etwa aufgrund einer verspäteten Klageerhebung (vgl. § 586 Abs. 1 ZPO)) bei widersprüchlichen Entscheidungen im Inland bleiben. Entsprechende Kollisionen von Entscheidungen können daher für sich genommen nicht als offensichtlich untragbar erscheinender Verstoß gegen wesentliche Rechtsgrundsätze des inländischen Rechts angesehen werden[11]. Dies muss zumindest gelten, solange nicht besondere Umstände hinzutreten, welche die Situation als unerträglich erscheinen lassen, etwa eine unangemessen kurze Frist zur Erhebung der Restitutionsklage, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist.
Der Versagungsgrund des Art. 34 Nr. 2 EuGVVO scheitert daran, dass die Antragsgegnerin bei einer Gehörsverletzung im verfahrenseinleitenden Stadium die Möglichkeit hatte, gegen die Entscheidung vom 06.03.2008 einen Rechtsbehelf einzulegen. Diese Möglichkeit hat sie jedoch nicht hinreichend genutzt. Die rechtzeitige Kenntnis der Antragsgegnerin vom Inhalt der Entscheidung[12] kann unterstellt werden; denn sie hat mit der Aufhebungsklage reagiert. Auf den Aufhebungsantrag hin hätte der Verfahrensfehler korrigiert werden können. Da die Antragsgegnerin jedoch die angeforderten Gebührenmarken ohne ersichtlichen Grund bei Gericht nicht hinterlegte, wurde ihr Antrag annulliert. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin rechtzeitig einen Rechtsbehelf gegen die möglicherweise verfahrensfehlerhaft ergangene Entscheidung eingelegt hat, zeigt, dass sie durch die in ihrer Abwesenheit ergangene Entscheidung nicht derart in ihren Verteidigungsrechten beschränkt wurde, dass der Entscheidung die Vollstreckbarerklärung nach Art. 34 Nr. 2 EuGVVO versagt werden müsste[13].
Es gibt schließlich keine Anhaltspunkte für das Eingreifen der übrigen in Art. 34, 35 EuGVVO genannten Versagungsgründe. Da mithin eine Versagung der Vollstreckbarerklärung der rumänischen Entscheidung allein nach Art. 34 Nr. 4 EuGVVO wegen der kollidierenden rumänischen Entscheidungen in Betracht kommt, ist es erforderlich, dem Gerichtshof der Europäischen Union die hierzu gestellte Frage zur Auslegung vorzulegen.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 8. März 2012 – IX ZB 144/10
- Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Abl. EG 2001 Nr. L 12/01 S. 1[↩]
- ABl.EU 2005 Nr. L 157/11[↩]
- Kropholler/v. Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., Art. 34 EuGVO Rn. 56; Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Art. 3436 EuGVVO Rn. 26; MünchKomm-ZPO/Gottwald, 2. Aufl., Art. 34 EuGVVO Rn. 42[↩]
- Rauscher/Leible, EuZPR/EuIPR, Art. 34 Brüssel I-VO Rn. 49a; HkZPO/Dörner, 4. Aufl., Art. 34 Rn. 25; Prütting/Gehrlein/Schinkels, ZPO, 3. Aufl. Art. 34 EuGVVO Rn. 12; Müller, IPRax 2009, 484, 486[↩]
- Müller, aaO S. 487[↩]
- vgl. Müller, aaO S. 486[↩]
- s. Kommissionsentwurf KOM (1999) 348 endg., S. 25[↩]
- vgl. Erwägungsgründe 16f zur EuGVVO[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 10.07.1986 – IX ZB 27/86, IPRax 1987, 236, 237; vom 06.05.2004 – IX ZB 43/03, WM 2004, 1391, 1393[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 12.12.2007 – XII ZB 240/05, NJW-RR 2008, 586 Rn. 22 ff; vom 03.08.2011 – XII ZB 187/10, NJW 2011, 3103 Rn. 24 zVb. in BGHZ; Schlosser, aaO Art. 3436 EuGVVO Rn. 34; Geimer in Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl., A. 1 Art. 34 Rn. 57 mwN[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 28.03.2000 – C-7/98, Krombach/Bamberski, Slg.2000, I01935 Rn. 37; BGH, Beschluss vom 26.09.1979 – VIII ZB 10/79, BGHZ 75, 167, 171[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 14.12.2006 – C-283/05, ASML/SEMIS, EWS 2007, 37 Rn. 39 ff; BGH, Urteil vom 12.12.2007, aaO Rn. 35[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 28.04.2009, C-420/07, Apostolides, Slg.2009, I – 03571 Rn. 78; OLG Köln, IPRspr.2006 Nr. 174; Kropholler/v. Hein, aaO Art. 34 EuGVVO Rn. 44; Rauscher/Leible, aaO Art. 34 Rn. 39a[↩]