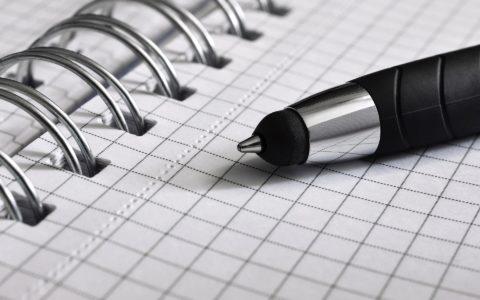Auf einen Vertrag mit Verbindung zu einem ausländischen Staat, durch den eine Vertragspartei der Schuld eines Dritten gegenüber der anderen Vertragspartei beitritt, ist gemäß Art. 28 Abs. 2 EGBGB grundsätzlich das Recht des Niederlassungsortes des Beitretenden anzuwenden. Allein der dem Schuldbeitritt immanente Zusammenhang mit dem Recht der ursprünglichen Schuld hat regelmäßig keine ausreichend starke Indizwirkung, um eine engere Verbindung im Sinne von Art. 28 Abs. 5 EGBGB zu begründen.

Für den Schuldbeitritt ist nach dem für die Beurteilung des Falles noch anwendbaren Art. 28 Abs. 2 Satz 2 EGBGB grundsätzlich an den Niederlassungsort des Beitretenden anzuknüpfen, denn dieser erbringt die charakteristische Leistung[1]. Nach Art. 28 Abs. 5 EGBGB kann eine akzessorische Anknüpfung an das Statut der übernommenen Schuld erfolgen, wenn zu diesem eine engere Verbindung als zum Niederlassungsort des Beitretenden besteht[2]. Allein der dem Schuldbeitritt immanente Zusammenhang mit dem Recht der ursprünglichen Schuld hat regelmäßig keine ausreichend starke Indizwirkung, um eine engere Verbindung im Sinne von Art. 28 Abs. 5 EGBGB zu begründen. Dies kann für den Schuldbeitritt nicht anders beurteilt werden als für die Bürgschaft und die Garantie, deren Statut regelmäßig an den Niederlassungsort des Bürgen bzw. Garanten angeknüpft wird[3] und von denen der Schuldbeitritt häufig abzugrenzen ist. Um zu vermeiden, dass diese Abgrenzung schon auf der kollisionsrechtlichen Ebene bei der Bestimmung des Vertragsstatuts vorgenommen werden muss, sind die einzelnen Sicherungsmittel nach denselben Kriterien anzuknüpfen[4].
Dabei hat es der Bundesgerichtshofs dahinstehen lassen, ob bei einer privativen Schuldübernahme das Recht der übernommenen Schuld maßgeblich wäre, was für den Bundesgerichtshof hinsichtlich der Beurteilung der Wirksamkeit der Verpflichtungen des Neuschuldners zweifelhaft ist[5].
Ebenfalls nicht entschieden hat der Bundesgerichtshof die umstrittene Frage, in welchem Rangverhältnis die einzelnen Absätze des Art. 28 EGBGB stehen[6]. Auch wenn man mit Teilen der Literatur davon ausgeht, dass Art. 28 Abs. 5 EGBGB der Vermutung des Art. 28 Abs. 2 EGBGB nicht als im Rang nachgeordnet anzusehen ist, bestand die engere Verbindung in dem jetzt vom BGH entschiedenen Fall zum Recht des Niederlassungsorts.
Zwei ggfs. auf deutsches Recht hinweisende Umstände hat der Bundesgerichtshof auch bei ihrem Zusammentreffen nicht das Gewicht beigemessen, das dem Niederlassungsort zukommt:
- Der Ort der Vertragsverhandlungen und des Vertragsabschlusses hat nur eine schwache Indizwirkung[7]. Er hängt häufig nur vom Zufall ab und besagt regelmäßig nichts über die Interessen der Vertragsparteien.
- Von nur geringer Bedeutung für die Anknüpfung wäre der Erfüllungsort, auch wenn er in Deutschland läge.
Den auf Deutschland hinweisenden Indizien steht als Anknüpfungsmerkmal der Niederlassungsort der Beklagten als Erbringer der charakteristischen Leistung gegenüber, dem das Gesetz durch die Vermutung des Art. 28 Abs. 2 EGBGB besonderes Gewicht beimisst. Dieses ist beim Schuldbeitritt als besonders hoch anzusehen, weil der Beitretende vom Vertragsstatut erheblich mehr betroffen ist als der Gläubiger der übernommenen Schuld. Dieser erbringt beim Schuldbeitritt keine Leistung. Er ist nicht besonders schützenswert, weil ihm lediglich ein weiterer Schuldner entsteht und er keine Nachteile aus dem Rechtsgeschäft erfährt. Insbesondere bleiben die Verpflichtungen aus dem Rechtsgeschäft mit dem ursprünglichen Schuldner bestehen.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11. November 2010 – VII ZR 44/10
- MünchKommBGB/Martiny, 4. Aufl., Art. 33 EGBGB Rn. 60; Staudinger/Hausmann, BGB (2002), Art. 33 EGBGB Rn. 96; Erman/Hohloch, BGB, 12. Aufl., Art. 33 EGBGB Rn. 13; von Bar, IPRax 1991, 197, 198; Girsberger, ZVglRWiss 88 (1989), 31, 37; Soergel/v. Hoffmann, BGB, 12. Aufl., Art. 33 Rn. 34; Siedel, Kollisionsrechtliche Anknüpfung vertraglicher und gesetzlicher Schuldübernahme, S. 74 ff.; a.A.: Kegel/Schurig, IPR, 9. Aufl., S. 761[↩]
- MünchKommBGB/Martiny, aaO, Rn. 60; einschränkend Staudinger/Hausmann, aaO, Rn. 96; Soergel/v. Hoffmann, aaO, Rn. 34[↩]
- BGH, Urteile vom 28.01.1993 – IX ZR 259/91, BGHZ 121, 224, 228; und vom 13.06.1996 – IX ZR 172/95, NJW 1996, 2569, 2570[↩]
- von Bar, aaO, S. 198; Staudinger/Hausmann, aaO, Rn. 96; Soergel/v. Hoffmann, aaO, Rn. 34; Girsberger aaO, S. 37; Siedel, aaO, S. 75 f.; MünchKommBGB/Martiny, BGB, 4. Aufl., Art. 33 Rn. 60[↩]
- vgl. Soergel/v. Hoffmann, aaO, Rn. 42; Staudinger/Hausmann, aaO, Rn. 100; MünchKommBGB/Martiny, aaO, Rn. 59; Girsberger, aaO[↩]
- vgl. zum Meinungsstand BGH, Urteil vom 26.07.2004 – VIII ZR 273/03, NJW-RR 2005, 206, 209; MünchKommBGB/Martiny, 4. Aufl., Art. 28 EGBGB Rn. 110[↩]
- vgl. BAGE 71, 297, 313; 63, 17, 28; RGZ 61, 343, 345 f.; Staudinger/Magnus, BGB (2002), Art. 28 EGBGB Rn. 45; MünchKommBGB/Martiny, 4. Aufl., Art. 28 EGBGB Rn. 94[↩]