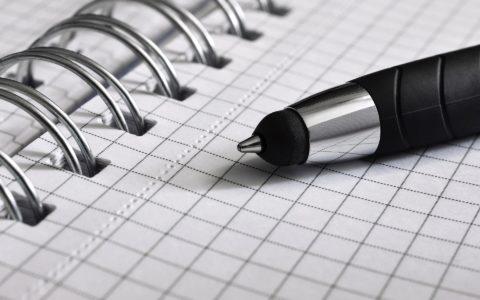Im Rahmen der Seefracht reicht es für die Annahme eines qualifizierten Verschuldens des Verfrachters wegen Verlustes des Transportguts nicht aus, dass das sperrige Transportgut (hier: ein Mobilkran mit einem Gewicht von 48.000 kg) auf seine Veranlassung vor der Schiffsverladung auf einem frei zugänglichen Gelände eines mitteleuropäischen Seehafens (hier: Antwerpen) verschlossen abgestellt worden ist.

In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall unterlag der Güterbeförderungsvertrag jedenfalls gemäß Art. 28 Abs. 4 Satz 1 EGBGB aF dem deutschen Recht. Denn sowohl die Auftraggeberin als auch der beklagte Verfrachter haben ihren Sitz in Deutschland. Darüber hinaus ergibt sich die Anwendung deutschen Rechts aus Art. 27 Abs. 2 Satz 1 EGBGB aF, da die Parteien durchweg auf der Grundlage deutscher Rechtsvorschriften vorgetragen haben[1].
Die Haftung für den Verlust der beiden Kräne beurteilt sich nach den Bestimmungen über die Haftung eines Verfrachters (§§ 556 ff. HGB). Der beklagte Spediteur hat die Besorgung der Versendung der beiden Kräne von Antwerpen nach Guyana auf dem Seeweg zu festen Kosten übernommen, so dass er hinsichtlich der Beförderung die Pflichten eines Verfrachters hatte (§ 459 Satz 1 HGB). Die als solche einheitliche Speditionsleistung hatte die Beförderung mit nur einem Transportmittel (Schiff) zum Gegenstand. Daraus ergibt sich die unmittelbare Anwendung des Seefrachtrechts.
Gemäß § 606 Satz 2 HGB haftet der Verfrachter für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung der Güter in der Zeit von der Annahme bis zur Ablieferung entsteht, es sei denn, der Verlust oder die Beschädigung beruht auf Umständen, die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters nicht abgewendet werden konnten. Ein Verschulden seiner Leute hat der Verfrachter nach § 607 Abs. 1 HGB in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden.
Im vorliegenden Fall ist der Schaden während der Obhutszeit des Verfrachters eingetreten. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Verfrachter die Kräne nach deren Anlieferung in Antwerpen durch das von ihm beauftragte Kaiumschlagsunternehmen A. zum Zweck der anschließend vorgesehenen Seebeförderung angenommen hat. Ab diesem Zeitpunkt haftete der Verfrachter gemäß § 606 Satz 2 HGB grundsätzlich für den Verlust des Gutes, und zwar unabhängig davon, welche Weisungen das Umschlagsunternehmen hinsichtlich des Ortes der Zwischenlagerung der Kräne bis zum Eintreffen des Seeschiffes erteilt hatte (§ 607 Abs. 1 HGB).
Der Umfang des von dem Verfrachter gemäß § 606 Satz 2 HGB zu leistenden Schadensersatzes bestimmt sich nach § 249 BGB[2]. Dementsprechend ist der Verfrachter grundsätzlich zum Ersatz des der Versicherungsnehmerin aufgrund des Diebstahls der Kräne entstandenen Schadens verpflichtet. Der gemäß § 249 BGB zu berechnende Schadensersatz wird allerdings – wenn kein qualifiziertes Verschulden nach § 660 Abs. 3 HGB vorliegt – durch die Regelungen in § 660 Abs. 1 Satz 1 HGB begrenzt. Nach dieser Vorschrift haftet der Verfrachter höchstens bis zu einem Betrag von 666,67 Rechnungseinheiten pro Frachtstück oder bis zu einem Betrag von zwei Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichts des abhandengekommenen Gutes, je nach dem, welcher Betrag höher ist. Gemäß § 660 Abs. 1 Satz 2 HGB ist die in Satz 1 genannte Rechnungseinheit das Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds. Der danach zu leistende Ersatz ist gemäß § 660 Abs. 1 Satz 3 HGB in Euro entsprechend dem Wert am Tag des Urteils über den Betrag der Haftung – eine davon abweichende Parteivereinbarung ist nicht dargetan – umzurechnen.
Im entschiedenen Fall war es dem Verfrachter jedoch nach § 660 Abs. 3 HGB nicht verwehrt, sich auf die Haftungsbegrenzung gemäß § 660 Abs. 1 Satz 1 HGB zu berufen, weil der durch den Verlust des Transportguts eingetretene Schaden auf ein qualifiziertes Verschulden des Verfrachters zurückzuführen sei. Gemäß § 660 Abs. 3 HGB verliert der Verfrachter sein Recht auf Haftungsbeschränkung nach Absatz 1, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die der Verfrachter in der Absicht, einen Schaden herbeizuführen oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen hat, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. Entsprechend dem Wortlaut des § 660 Abs. 3 HGB, in dem nur vom „Verfrachter“ und nicht auch – wie etwa in § 435 HGB – von den in § 428 HGB genannten Personen die Rede ist, führt nur ein qualifiziertes Verschulden des Verfrachters selbst zum Wegfall der Haftungsbeschränkung nach § 660 Abs. 1 HGB. Die Vorschrift des § 607 Abs. 1 HGB findet – wie der Bundesgerichtshof zwischenzeitlich entschieden hat – im Rahmen von § 660 Abs. 3 HGB keine Anwendung[3].
Handelt es sich bei dem in Anspruch genommenen Verfrachter um eine juristische Person oder – wie im Streitfall – um eine Kapitalgesellschaft, erfordert der Verlust des Rechts auf Haftungsbeschränkungen ein qualifiziertes Verschulden der Organe des Anspruchsgegners, hier also des Geschäftsführers der Beklagten[4].
Das Berufungsgericht hat seine Annahme, der streitgegenständliche Schaden sei auf ein Verschulden der Beklagten im Sinne von § 660 Abs. 3 HGB zurückzuführen, darauf gestützt, dass die Beklagte nach der Anlieferung der beiden Kräne nicht in ausreichendem Maße für deren Sicherung gegen Diebstahl gesorgt habe. Es hat darauf abgestellt, dass die Kräne nach dem eigenen Vortrag der Beklagten lediglich durch Abziehen der Zündschlüssel gesichert worden seien. Dagegen sei offengeblieben, wer die Schlüssel bis zur Verschiffung habe verwahren sollen und ob das Kaiumschlagsunternehmen diese – gegebenenfalls auf welche Weise – gegen unbefugten Zugriff gesichert habe. Die Kräne hätten tagelang außerhalb der Sichtweite des Büros des Kaiumschlagsbetriebs gestanden. Auf einem frei zugänglichen Hafengelände sei Gut, das mobil und unbewacht sei, in hohem Maße diebstahlgefährdet.
Das Berufungsgericht hat auf dieser Grundlage zu Unrecht ein qualifiziertes Verschulden des beklagten Verfrachters bejaht. Es hat nicht berücksichtigt, dass nur ein eigenes Verschulden des Verfrachters gemäß § 660 Abs. 3 HGB zur Durchbrechung der Haftungsbeschränkung nach § 660 Abs. 1 HGB führt. Vielmehr ist das Berufungsgericht ersichtlich davon ausgegangen, dass sich die Beklagte ein pflichtwidriges Verhalten des Kaiumschlagsunternehmens gemäß § 278 BGB zurechnen lassen muss.
Die Annahme eines qualifizierten Verschuldens kann zwar auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Verfrachter die ihm insoweit obliegende sekundäre Darlegungslast nicht erfüllt[5]. Jedoch hat der Verfrachter dargetan hat, wo die Kräne abgestellt waren, dass sie verschlossen und die Schlüssel bei dem Kaiumschlagsunternehmen abgegeben worden waren. Des Weiteren hat der Verfrachter vorgetragen, dass die zur Aufbewahrung gegebenen Schlüssel nach dem Diebstahl bei dem Kaiumschlagsunternehmen noch vorhanden waren. Unberücksichtigt geblieben ist auch der Vortrag des Verfrachters, das sperrige Gut habe auf dem Hafengelände in Antwerpen nur frei gelagert werden können, wobei eine solche Lagerung dort allgemein üblich sei und die Beklagte sich an die dort geltenden Sicherheitsstandards gehalten habe. Mit Recht beanstandet die Revision ferner, das Berufungsgericht habe nicht gewürdigt, dass es sich bei den Mobilkränen mit einem Gewicht von jeweils 48.000 kg nicht um Gut handelt, das ohne weiteres leicht verwertbar ist. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen daher nicht die Annahme eines qualifizierten Verschuldens der Beklagten im Sinne von § 660 Abs. 3 HGB.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. November 2010 – I ZR 192/08
- vgl. BGH, Urteil vom 30.10.2008 – I ZR 12/06, TranspR 2009, 130 Rn. 19 = VersR 2009, 1141[↩]
- BGH, Urteil vom 18.06.2009 – I ZR 140/06, BGHZ 181, 292 Rn. 28; Rabe, Seehandelsrecht, 4. Aufl., § 606 HGB Rn. 44[↩]
- BGHZ 181, 292 Rn. 34 ff.; ebenso: Rabe aaO § 660 HGB Rn. 26; ders., TranspR 2004, 142, 144; Herber, Das neue Haftungsrecht der Schifffahrt, 1989, S. 315 f.; ders., Seehandelsrecht, 1999, S. 332 f.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 03.11.2005 – I ZR 325/02, TranspR 2006, 35, 37, insoweit nicht in BGHZ 164, 394; BGHZ 181, 292 Rn. 39[↩]
- BGH, Urteil vom 29.07.2009 – I ZR 212/06, TranspR 2009, 331 Rn. 34[↩]