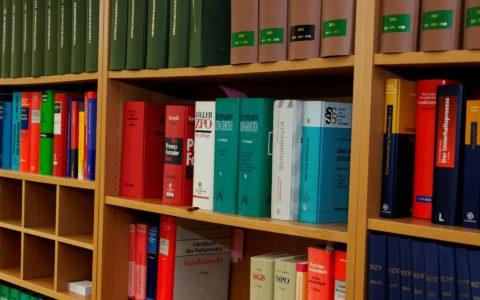Bei einem dem UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG) unterliegenden internationalen Warenkauf beurteilt sich ein gesetzlicher Schuldbeitritt aufgrund Firmenfortführung nach dem am Ort der gewerblichen Niederlassung des fortgeführten Unternehmens geltenden Recht (Firmenstatut).

Für die auf eine Firmenfortführung gestützte Haftung des Käufers findet unvereinheitlichtes deutsches Recht und damit § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB Anwendung. Denn der Kaufpreisanspruch (Art. 53 CISG) aufgrund eines (gesetzlichen oder vertraglichen) Schuldbeitritts beruht nicht auf einer vom Schuldner nach Maßgabe von Art. 14 ff. CISG originär eingegangenen Verpflichtung, sondern darauf, dass der Beitretende die in der Person der Schuldnerin begründeten kaufvertraglichen Pflichten nachträglich übernommen haben soll. Diese Frage behandelt das UN-Kaufrechtsübereinkommen, das nach Art. 4 Satz 1 CISG ausschließlich den Abschluss des Kaufvertrages und die aus ihm erwachsenden Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käufers regelt, nicht. Sie ist vielmehr nach Maßgabe des nach den Regeln des internationalen Privatrechts zu bestimmenden nationalen Rechts zu beantworten.
Es besteht in der internationalen Rechtspraxis weitgehende Übereinstimmung, dass sich die Voraussetzungen, Wirkungen und Folgen einer Schuldübernahme und eines Schuldbeitritts allein nach dem hierfür anwendbaren nationalen Recht beurteilen[1]. Das hat erst recht zu gelten, wenn ein Schuldbeitritt, wie er in § 25 HGB geregelt ist, nicht auf vertraglicher Vereinbarung beruht, sondern bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen nachträglich kraft Gesetzes eintritt[2].
Für die Haftung des Erwerbers aus einer Firmenfortführung für Verbindlichkeiten des fortgeführten Unternehmens ist nach – jedenfalls für die hier maßgebliche Zeit vor Inkrafttreten der RomVerordnungen – allgemeiner Auffassung nicht an das – vorliegend italienische – Vertragsstatut, das dazu in Art. 2560 Abs. 2 CC eigene Regeln enthält[3], sondern an das Recht am Ort der gewerblichen Niederlassung des fortgeführten Unternehmens als dem Firmenstatut anzuknüpfen. Denn allein dieses Recht ist berufen, über einen kraft Gesetzes eintretenden Übergang von Rechten und Pflichten aus einem in seinem Geltungsbereich ansässigen Handelsgeschäft im Falle der Fortführung durch einen Dritten zu entscheiden[4]. Das führt angesichts der in Deutschland gelegenen Niederlassung der Schuldnerin kollisionsrechtlich zur Anwendbarkeit von § 25 HGB.
Bundesgerichtshof, Versäumnisurteil vom 23. Oktober 2013 – VIII ZR 423/12
- Staudinger/Magnus, BGB, Neubearb.2013, Art. 4 CISG Rn. 57 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 08.05.1989 – II ZR 237/88, WM 1989, 1219 unter 3 b; vom 05.03.1974 – VI ZR 240/73, WM 1974, 395, 396; vom 26.11.1964 – VII ZR 75/63, BGHZ 42, 381, 384; RGZ 135, 104, 107 f.; ebenso zum gesetzlichen Forderungsübergang von Ansprüchen aus der CMR BGH, Urteil vom 12.02.1998 – I ZR 5/96, WM 1998, 2077 unter II 1 b aa[↩]
- dazu Merkt/Dunckel, RIW 1996, 533, 536[↩]
- MünchKomm-BGB/Kindler, 5. Aufl., IntGesR Rn. 253; Merkt/Dunckel, aaO S. 542; Freitag, ZHR 174 [2010], 429, 431 f.; jeweils mwN[↩]