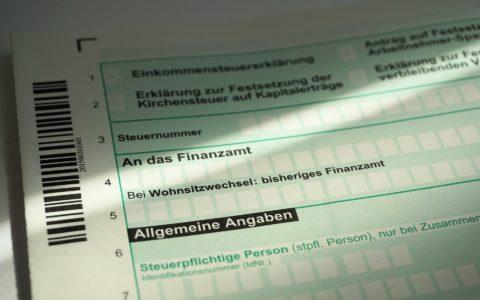Die nach § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 zum Nachweis der Höhe der nicht der deutschen Steuer unterliegenden Einkünfte erforderliche Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde ist – als sog. Nullbescheinigung – auch dann vorzulegen, wenn der Steuerpflichtige angibt, keine derartigen Einkünfte erzielt zu haben.

Nach § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG 2002 können nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten auf Antrag gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG (i.V.m. § 26b EStG 2002) zusammen veranlagt werden, wenn nur einer von ihnen die Voraussetzungen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG 2002 oder der „fiktiven unbeschränkten Einkommensteuerpflicht“ nach § 1 Abs. 3 EStG 2002 erfüllt. Voraussetzung ist zum einen, dass der unbeschränkt steuerpflichtige Ehegatte Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist und der andere Ehegatte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im EU/EWR-Ausland hat. Zum anderen sind die Einkunftsgrenzen des § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG 2002 zu beachten. Hierbei ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der nach der bis zum Jahressteuergesetz 2008[1] geltenden Gesetzesfassung maßgebliche Betrag von 6.136 € zu verdoppeln (§ 1a Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG 2002).
Eine Zusammenveranlagung ist danach nur dann möglich, wenn entweder die Einkünfte beider Ehegatten im Kalenderjahr mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer unterliegen (sog. relative Wesentlichkeitsgrenze) oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Betrag von 12.272 EUR nicht übersteigen (sog. absolute Wesentlichkeitsgrenze). Die Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte muss zudem gemäß § 1a Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002[2] durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen werden.
Aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 („Weitere Voraussetzung ist …“) ergibt sich, dass es sich bei dem Erfordernis der Vorlage einer Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde um eine materielle Tatbestandsvoraussetzung und nicht um ein bloßes Beweismittel handelt[3].
Entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung[4] ist die Bescheinigung auch dann beizubringen, wenn die Ehegatten gegenüber dem Finanzamt erklären, keine nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte erzielt zu haben[5]. Denn auch durch die Bezifferung mit Null wird eine bestimmte Höhe der betreffenden Einkünfte beschrieben.
Für die Pflicht zur Vorlage auch einer sog. „Nullbescheinigung“ spricht insbesondere, dass nach dem Gesetzeszweck die Vorlage der Bescheinigung gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 nicht allein der Erleichterung der Berechnung der Einkünfte, sondern auch der Verhinderung der Inanspruchnahme ungerechtfertigter Steuervorteile dienen soll[6]. Um die Angaben der Steuerpflichtigen auf ihre Plausibilität zu überprüfen, ist eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Ansässigkeitsstaats über die nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte bei behaupteten Nulleinkünften in gleichem Maße dienlich wie bei Behauptung jedes anderen, unterhalb des Grenzbetrages liegenden Einkunftsbetrages.
Soweit gegen die Pflicht zur Vorlage von „Nullbescheinigungen“ eingewendet wird, die ausländischen Steuerbehörden stellten solche grundsätzlich nicht aus[7], besteht aus der Sicht des Bundesfinanzhofs kein Anhalt dafür, dass dies generell für alle ausländischen Finanzbehörden zutrifft. So haben die Kläger nach den Feststellungen des FG für die Jahre 2004 und 2005 Bescheinigungen der französischen Steuerbehörden vorgelegt, die keine Einkünfte ausgewiesen haben, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterlegen haben. Es besteht deshalb kein Grund zu der Annahme, die Vorlage einer „Nullbescheinigung“ für das Streitjahr sei nur deshalb unterblieben, weil die französischen Behörden solche Bescheinigungen grundsätzlich nicht ausstellten.
Soweit ausländische Finanzbehörden Bescheinigungen nach § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 nicht ausstellen, lässt die deutsche Finanzverwaltung im Übrigen für Nicht-EU/EWR-Mitgliedstaaten die Vorlage einer Bescheinigung einer deutschen Auslandsvertretung ausreichen, in der dies bestätigt wird[8]. Diese Billigkeitsregelung könnte ggf. auch auf den Fall, dass ein EU/EWR-Mitgliedstaat die Ausstellung von „Nullbescheinigungen“ verweigern sollte, übertragen werden.
Keiner Entscheidung bedarf im Streitfall, ob die Vorlage einer Bescheinigung gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 entbehrlich ist, wenn zwischen den Beteiligten unstreitig ist, dass die Steuerpflichtigen nur im Inland, nicht dagegen im Ansässigkeitsstaat Einkünfte erzielt haben[9], denn das Finanzamt hat die entsprechende Behauptung der Kläger nicht unstreitig gestellt.
Die Verwendung eines bestimmten Vordrucks für die Bescheinigung wird von § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG 2002 nicht vorgeschrieben[10]. Dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums[11], in dem es heißt, die Bescheinigung sei „auf amtlichen Vordrucken zu erteilen“, kommt als Verwaltungsanweisung keine Gesetzeskraft zu, so dass daraus eine Rechtspflicht zur Verwendung des Vordrucks nicht abgeleitet werden kann. Da es sich bei der Vorlage der Bescheinigung –auch nach Auffassung der Finanzverwaltung– um ein materielles Tatbestandserfordernis handelt, sind auch weder die Ermächtigungsgrundlage des § 51 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c EStG 2002 noch die verfahrensrechtliche Pflicht des § 150 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung einschlägig. Die Vordruckverwendung als weitere materielle Tatbestandsvoraussetzung hätte vielmehr gesondert gesetzlich angeordnet werden müssen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 8. September 2010 – I R 80/09
- vom 20.12.2007, BGBl I 2007, 3150[↩]
- in der Gesetzesfassung nach dem Jahressteuergesetz 2008: § 1 Abs. 3 Satz 5 EStG 2002/2009[↩]
- ebenso FG Brandenburg, Urteil vom 17.08.2005 – 4 K 1467/01, EFG 2005, 1706; Niedersächsisches FG, Urteil vom 28.02.2007 – 2 K 381/05, EFG 2007, 1442; Ebling in Blümich, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, § 1 EStG Rz 299; Gosch in Kirchhof, Einkommensteuergesetz, 9. Aufl., § 1 Rz 23; Lehner/Waldhoff in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, § 1 Rz D 151; Herlinghaus, EFG 2007, 1443; a.A. –aufgrund gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung– Hahn, jurisPR-SteuerR 3/2006 Anm. 1[↩]
- Lehner/Waldhoff in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 1 Rz D 152; Stapperfend in Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, § 1 EStG Rz 285; Herlinghaus, EFG 2007, 1443, 1444[↩]
- ebenso Niedersächsisches FG, Urteil in EFG 2007, 1442[↩]
- vgl. erste Beschlussempfehlung und erster Bericht des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages zum Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 1996, BT-Drs. 13/1558, S. 150[↩]
- Herlinghaus, EFG 2007, 1443, 1444[↩]
- BMF, Schreiben vom 30.12.1996, BStBl I 1996, 1506, Tz. 1[↩]
- so FG Brandenburg, Urteil in EFG 2005, 1706[↩]
- ebenso Niedersächsisches FG, Urteil in EFG 2007, 1442; Stapperfend in Herrmann/Heuer/Raupach, a.a.O., § 1 EStG Rz 285[↩]
- BMF, Schreiben in BStBl I 1996, Tz. 1[↩]