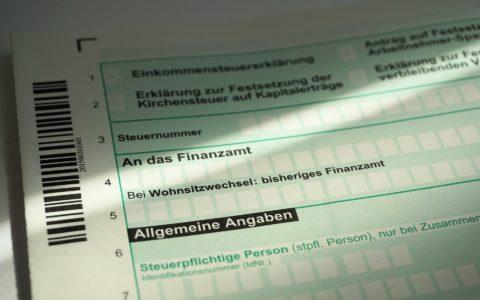Soll bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung die Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegmäßig durch einen CMR-Frachtbrief nachgewiesen werden, ist es grundsätzlich erforderlich, die für die Ablieferung vorgesehene Stelle (Bestimmungsort) anzugeben.

Im Rahmen des Nachweises einer innergemeinschaftlichen Lieferung kan ein CMR-Frachtbrief ein geeigneter Versendungsbeleg im Sinne des § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. § 17a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und § 10 Abs. 1 UStDV sein.
Versendet wie im Streitfall der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, soll der Unternehmer den Nachweis hierüber durch das Doppel der Rechnung im Sinne der §§ 14, 14a UStG und durch einen Beleg entsprechend § 10 Abs. 1 UStDV führen (§ 17a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 UStDV).
Diesen Belegnachweis soll der Unternehmer durch einen Versendungsbeleg, insbesondere durch Frachtbrief, Konnossement, Posteinlieferungsschein (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 UStDV) oder sonstigen handelsüblichen Beleg, insbesondere durch eine Spediteurbescheinigung oder eine Versandbestätigung des Lieferers (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 UStDV) erbringen.
Ein CMR-Frachtbrief ist als Frachtbrief im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 UStDV anzusehen[1]. Auch die Finanzverwaltung erkennt nunmehr einen CMR-Frachtbrief als belegmäßigen Nachweis an[2].
Auch scheidet ein CMR-Frachtbrief nicht bereits deshalb als geeigneter Versendungsbeleg aus, weil das Formular in Feld 24 nicht oder unvollständig ausgefüllt ist. Für die Anerkennung eines CMR-Frachtbriefs als Versendungsbeleg nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 UStDV kommt es nicht darauf an, dass dieser die in Feld 24 vorgesehene Empfängerbestätigung aufweist[3].
Allerdings ist die Angabe des Bestimmungsortes grundsätzlich erforderlich, um die Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegmäßig nachzuweisen. Denn die für die Ablieferung vorgesehene Stelle muss sowohl nach § 408 Abs. 1 Nr. 4 HGB als auch nach Art. 6 Nr. 1 Buchst. d CMR-Übereinkommen aus einem Frachtbrief hervorgehen. Ob ausnahmsweise bei einem Reihengeschäft zum Schutz der Geschäftsbeziehungen auch die Angabe des Bestimmungslandes ausreichend sein kann[4], kann im Streitfall offenbleiben. Denn einen solchen Fall wurde hier nicht festgestellt.
Mit dieser Auffassung, dass sich die für die Ablieferung vorgesehene Stelle aus dem Frachtbrief ergeben muss, weicht der Bundesfinanzhof nicht von der Rechtsprechung des V. Senats des Bundesfinanzhofs ab. Dieser hat es in Abholfällen unter Hinweis auf das Fehlen handelsüblicher Belege nicht beanstandet, dass für die Angabe des Bestimmungsortes die Rechnungsanschrift als ausreichend angesehen wurde[5]. Dagegen gibt es in Fällen einer Versendung mit einem Frachtbrief einen handelsüblichen Beleg, in dem –wie dargelegt– der Bestimmungsort anzugeben ist.
Deshalb vermag der Bundesfinanzhof auch der in der Literatur zum Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungsfällen nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV vertretenen Ansicht, die Angabe des Bestimmungsortes dürfe in den nationalen Nachweis- und Kontrollregeln nicht maßgebend sein, weil sie kein Kriterium nach Art. 28c Teil A Buchst. a Unterabs. 1 der Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie[6] –nunmehr Art. 138 Abs. 1 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie[7]— sei[8], nicht zu folgen. Im Übrigen ist es Sache der Mitgliedstaaten, unter Beachtung der allgemeinen Rechtsgrundsätze der Europäischen Union zu bestimmen, welche Beweise die Steuerpflichtigen vorlegen müssen, um in den Genuss der Mehrwertsteuerbefreiung zu gelangen, eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern[9].
Da es sich bei § 17a Abs. 4 Satz 1 UStDV um eine Sollvorschrift über die an den Nachweis nach § 17a Abs. 1 UStDV zu stellenden Anforderungen handelt[10], bleibt es dem Unternehmer allerdings unbenommen, einen geeigneten Ersatzbeleg vorzulegen, soweit sich der Ort der voraussichtlichen Auslieferung der vom Frachtführer in Empfang genommenen Ware nicht aus dem Frachtbrief ergibt.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 4. Mai 2011 – XI R 10/09
- vgl. BFH, Urteil vom 12.05.2000 – V R 65/06, BFHE 225, 264, BStBl II 2010, 511, unter II.B.03.b[↩]
- BMF, Schreiben vom 05.05.2010 – IV D 3 – S 7141/ 08/10001, 2010/0334195, BStBl I 2010, 508, Rz 37[↩]
- vgl. BFH, Urteil in BFHE 225, 264, BStBl II 2010, 511, unter II.B.03.c; a.A. BMF-Schreiben in BStBl I 2010, 508, Rz 38[↩]
- vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.10.2010 – 6 K 1643/08, EFG 2011, 670, Revision eingelegt: BFH – XI R 42/10[↩]
- vgl. BFH, Urteil vom 07.12.2006 – V R 52/03, BFHE 216, 367, BStBl II 2007, 420, unter II.02.c[↩]
- Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern[↩]
- Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl.EU Nr. L 347/1[↩]
- vgl. Wagner, Haufe Steuer Office, Haufe-Index 1969513, Stand 08.11.2007[↩]
- vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 07.12. 2010 – C-285/09 -R-, DStR 2010, 2572, UR 2011, 15, Rz 43 f., m.w.N.[↩]
- vgl. BFH, Urteil in BFHE 216, 367, BStBl II 2007, 420, unter II.2.c[↩]