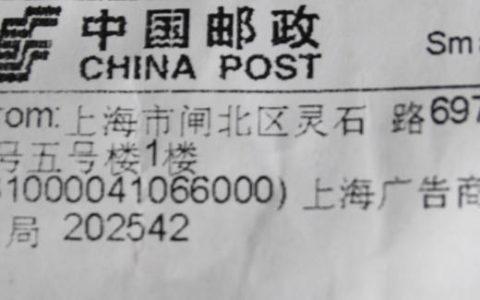Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, mit der sich ein usbekischer und russischer Staatsangehöriger gegen die Durchsuchung seiner Motoryacht wendet.

Die Durchsuchung steht in Zusammenhang mit Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Staatsangehörige – darunter der Yachtbesitzer – in Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine. Der Yachtbesitzer war zumindest in der Vergangenheit geschäftlich in Russland tätig. Wegen des Verdachts strafbarer Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung einer Motoryacht an, die die Staatsanwaltschaft dem Yachtbesitzer wirtschaftlich zurechnete. Dieser sieht sich durch die Durchsuchungsanordnung in mehreren Grundrechten verletzt, insbesondere in Art. 13 Abs. 1 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) sowie – wegen Medienberichten nach der Durchsuchung – in seinem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht.
Die Verfassungsbeschwerde sei, so das Bundesverfassungsgericht in seinem Nichtannahmebeschluss, offensichtlich unzulässig. Soweit sich der Yachtbesitzer gegen die Medienberichterstattung wendet, fehlt es an der erforderlichen Rechtswegerschöpfung. Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist insoweit nicht die Durchsuchungsordnung als solche, sondern allein die Art und Weise der Durchsuchung, gegen die der Yachtbesitzer zunächst die Fachgerichte hätte anrufen müssen. Soweit er sich gegen die Durchsuchungsanordnung wendet und eine Verletzung des Art. 13 Abs. 1 GG rügt, hat der Yachtbesitzer insbesondere seine Beschwerdebefugnis nicht hinreichend dargelegt. Er hat es versäumt aufzuzeigen, dass die Motoryacht seiner räumlichen Privatsphäre zuzurechnen ist und damit in den ihm zuzuordnenden persönlichen Schutzbereich des Art. 13 Abs. 1 GG fällt. Im Hinblick auf seine weiteren Grundrechtsrügen hat der Yachtbesitzer ein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis nicht hinreichend dargelegt.
Der Ausgangssachverhalt
Der Yachtbesitzer, ein usbekischer und russischer Staatsangehöriger, war zumindest in der Vergangenheit in Russland geschäftlich tätig. In Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine setzte die Europäische Union den Yachtbesitzer auf ihre Sanktionsliste[1]. Rechtsgrundlage der Sanktionen sind der auf Art. 29 EUV und damit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) beruhende Beschluss des Rates 2014/145/GASP vom 17.03.2014[2] sowie die auf Grundlage dieses Beschlusses und Art. 215 AEUV erlassene Verordnung (EU) Nr. 269/2014 vom 17.03.2014[3]. Gegen seine Listung auf der Sanktionsliste hat der Yachtbesitzer Nichtigkeitsklage vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) erhoben.
Am 26.09.2022 ordnete das Amtsgericht München die Durchsuchung einer Motoryacht an, die dem Yachtbesitzer nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wirtschaftlich zuzurechnen sei[4]. Es bestehe der Verdacht, dass der Yachtbesitzer seiner Pflicht zur Anzeige von Wertgegenständen nach § 23a des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) in der damals geltenden Fassung nicht nachgekommen sei, was gemäß § 18 Abs. 5b AWG strafbar sei. Die Durchsuchung wurde am 27.09.2022 vollzogen. Die gegen die Durchsuchungsanordnung gerichtete Beschwerde verwarf das Landgericht München I als unbegründet[5]. Der für die Anordnung einer Durchsuchung erforderliche Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung liege vor. Eine Aussetzung zur Vorlage der § 18 Abs. 5b, § 23a AWG a.F. nach Art. 100 GG komme mangels Entscheidungserheblichkeit nicht in Betracht, da unter „Entscheidung“ insoweit erst die abschließende Sachentscheidung zu verstehen sei. Bei der Beschwerdeentscheidung handele es sich nicht um eine solche, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Auch eine Vorlage nach Art. 267 AEUV sei nicht veranlasst. Das Gericht halte die unionsrechtliche Listung des Yachtbesitzers nicht für ungültig und sehe sich auch sonst nicht zu einer Vorlage verpflichtet. Die Interessenlage sei hier mit der in einem summarischen Verfahren vergleichbar. In solchen Verfahren sei auch ein letztinstanzliches Gericht nicht gehalten, ein Vorabentscheidungsverfahren einzuleiten. Eine dagegen angebrachte Anhörungsrüge blieb ohne Erfolg[6].
Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Yachtbesitzer die Verletzung mehrerer Grundrechte. Insbesondere habe das Landgericht seinen Vortrag zu Art. 13 Abs. 1 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) nicht beachtet. Die tatsächlich durchgeführte Durchsuchung verletze den Yachtbesitzer in seinem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht, weil die Presse über diese umfangreich berichtet habe, wodurch sein Ruf erheblich beeinträchtigt worden sei.
Die Entscheidung des BVerfG
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil sie offensichtlich unzulässig sei:
Soweit sich der Yachtbesitzer gegen die nach Durchführung der Durchsuchung erfolgte Medienberichterstattung wendet und eine Verletzung von Art. 2 Abs.1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als allgemeines Persönlichkeitsrecht rügt, fehlt es bereits an der formellen Erschöpfung des Rechtswegs. Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist insoweit allein die Art und Weise der Durchsuchung, gegen die als Rechtsweg der Antrag auf gerichtliche Entscheidung analog § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO zur Verfügung steht[7]. Dass der Yachtbesitzer einen solchen Antrag gestellt hat, hat er weder dargelegt noch ist dies sonst ersichtlich.
Die gegen die Durchsuchungsanordnung gerichtete Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Soweit er eine Verletzung des Art. 13 Abs. 1 GG rügt, genügt seine Verfassungsbeschwerde weder den sich aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG ergebenden Darlegungsanforderungen an eine mögliche Grundrechtsverletzung (a) noch den Anforderungen der materiellen Subsidiarität (b). Im Hinblick auf seine weiteren Grundrechtsrügen hat er ein Rechtsschutzbedürfnis nicht aufgezeigt (c).
Aus dem Vortrag des Yachtbesitzers ergibt sich nicht, dass er durch die Durchsuchungsanordnung und die daraufhin ergangene Beschwerdeentscheidung in seinem Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG verletzt sein könnte. Insoweit genügt die Verfassungsbeschwerde nicht den gesetzlichen Begründungsanforderungen (§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG). Danach muss deutlich werden, inwieweit er selbst durch die angegriffene Maßnahme in dem bezeichneten Grundrecht verletzt sein soll[8]. Daran fehlt es hier. Der Yachtbesitzer hat nicht aufgezeigt, in Hinblick auf die Motoryacht überhaupt Träger des Grundrechts aus Art. 13 Abs. 1 GG zu sein. Denn er hat nicht dargelegt, dass diese seiner räumlichen Privatsphäre zuzurechnen ist.
Mit der Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung durch Art. 13 Abs. 1 GG erfährt die räumliche Lebenssphäre des Einzelnen einen besonderen grundrechtlichen Schutz[9]. Geschützt ist nicht das Besitzrecht an einer Wohnung, sondern deren Privatheit. Schutzgut ist die räumliche Sphäre, in der sich das Privatleben entfaltet[10]. Art. 13 Abs. 1 GG verbürgt dem Einzelnen mit Blick auf die Menschenwürde sowie im Interesse der Entfaltung der Persönlichkeit einen elementaren Lebensraum[11]. Damit fallen unter den Tatbestand der Wohnung alle der räumlichen Privatsphäre zuzuordnenden Räume[12], also privaten Wohnzwecken gewidmete Räumlichkeiten, in denen der Mensch das Recht hat, in Ruhe gelassen zu werden[13].
Wer Träger des Grundrechts des Art. 13 Abs. 1 GG ist, entscheidet sich daher nicht nach der Eigentumslage, sondern grundsätzlich danach, wer Nutzungsberechtigter der Wohnung ist[14] und diese auch tatsächlich zu privaten Wohnzwecken selbst nutzt[15]. Nicht geschützt ist demgegenüber der nur mittelbare Besitzer, also der den Wohnraum selbst nicht innehabende Eigentümer, Vermieter oder auch Untervermieter[16].
Jedenfalls bei nicht eindeutigen Besitzverhältnissen bedarf es substantiierten Vortrags dazu, warum die persönliche Privatsphäre einer natürlichen Person von der Durchsuchung berührt und sie in ihrem eigenen Wohnungsgrundrecht betroffen sein soll[17].
Danach hat der Yachtbesitzer seine Beschwerdebefugnis nicht hinreichend dargelegt.
Soweit der Yachtbesitzer seine Betroffenheit allein damit begründet, dass er Adressat der Durchsuchungsanordnung gewesen sei, vermag dies seine Grundrechtsträgerschaft für sich genommen nicht zu begründen. Denn auch bei einem durchsuchten Objekt, das sachlich in den Schutzbereich von Art. 13 Abs. 1 GG fällt, ist der persönliche Schutzbereich nicht berührt, wenn keine erkennbare Verbindung zum Adressaten des Beschlusses besteht, weil es sich etwa um eine fremde Wohnung handelt oder aber die eigene Privatsphäre des Adressaten aus anderen Gründen nicht betroffen sein kann.
Eine mögliche Grundrechtsträgerschaft ergibt sich auch nicht aus dem sonstigen Sachvortrag des Yachtbesitzers. Zwar trägt er vor, die Motoryacht als Mieter genutzt zu haben. Zu den tatsächlichen Umständen seines Besitzes macht er allerdings keine Angaben. Die bloße schuldrechtliche Besitzberechtigung von Räumen aufgrund eines Mietvertrags genügt aber allein nicht, um den persönlichen Schutzbereich des Art. 13 Abs. 1 GG für diese Räume zu eröffnen. Entscheidend ist vielmehr, ob und inwieweit diese Räume auch tatsächlich der räumlichen Privatsphäre des Yachtbesitzers zuzuordnen sind. Zur tatsächlichen Nutzung verhält sich die Verfassungsbeschwerde aber auch in einer Gesamtschau nicht. Weder spezifiziert der Yachtbesitzer, ob er die Motoryacht für persönliche oder gewerbliche Zwecke für sich selbst oder andere tatsächlich genutzt oder besessen hat, noch, in welchem Zeitraum eine tatsächliche Nutzung oder ein Besitz des Yachtbesitzers vorlag und ob er überhaupt jemals selbst an Bord der Motoryacht war. Der Yachtbesitzer nimmt lediglich auf ein Schreiben vom 20.08.2022 Bezug, wonach all die persönlichen Gegenstände, die er im Geltungsbereich des Außenwirtschaftsgesetzes besitzt, sich in einer Liegenschaft in (…) befänden.
Jedenfalls aber genügt die Verfassungsbeschwerde im Hinblick auf die Rüge des Art. 13 Abs. 1 GG nicht den Anforderungen der materiellen Subsidiarität.
Vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde muss ein Yachtbesitzer über die bloße formelle Erschöpfung des Rechtswegs hinaus alle nach Lage der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung in dem unmittelbar mit ihr zusammenhängenden sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen[18]. Einem Yachtbesitzer obliegt es daher im Ausgangsverfahren einer Verfassungsbeschwerde, den Sachverhalt so darzulegen, dass eine verfassungsrechtliche Prüfung möglich ist[19]. Ein grundsätzlich neuer Tatsachenvortrag im Verfahren der Verfassungsbeschwerde ist ausgeschlossen[20]. Hat ein Yachtbesitzer im Ausgangsverfahren die Tatsachen dort nicht vollständig vorgebracht, hat er nicht alles ihm Zumutbare getan, um eine fachgerichtliche Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen[21].
Der Yachtbesitzer hat in seinem Vorbringen vor den Fachgerichten keine hinreichenden tatsächlichen Umstände dafür vorgetragen, dass die Durchsuchung der Motoryacht den Schutzbereich von Art. 13 Abs. 1 GG berühren könnte. Das Landgericht war dementsprechend nicht gehalten, die Durchsuchungsanordnung am Maßstab des Art. 13 Abs. 1 GG auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Eine solche Prüfung mit seinem Vortrag zu den tatsächlichen Umständen zu ermöglichen, war jedoch Aufgabe des Yachtbesitzers[22].
So hat der Yachtbesitzer auch im fachgerichtlichen Verfahren seine Betroffenheit in Hinblick auf Art. 13 Abs. 1 GG allein damit begründet, dass er Adressat der Maßnahme gewesen sei. Daneben hat er keine tatsächlichen Umstände vorgetragen, die auf eine Eröffnung des persönlichen Schutzbereichs schließen ließen, sondern hat lediglich mitgeteilt, dass er nicht Eigentümer der Motoryacht sei, auch sonst keinerlei Kontrolle über diese habe und darüber hinaus auf das Schreiben von 20.08.2022 verwiesen, in dem es heißt, der Yachtbesitzer besitze lediglich Mobiliar, Haushaltsgegenstände und persönliche Effekte, die sich in einer Liegenschaft in (…) befänden. Auch hat er ausdrücklich nicht bestätigt, dass all die auf der Yacht gefundenen Gegenstände ihm gehörten. Dass der Yachtbesitzer die Motoryacht als Mieter genutzt habe, weshalb der Schutzbereich grundsätzlich eröffnet sein könnte, trägt er erstmals mit seiner Verfassungsbeschwerde vor.
Der Yachtbesitzer hat schließlich im Hinblick auf seine weiteren Grundrechtsrügen kein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis dargelegt.
Nach der Erledigung einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme muss von Verfassungs wegen grundsätzlich kein lückenloser voraussetzungsloser Rechtsschutz gewährt werden. Vielmehr ist mit deren Erledigung anzunehmen, dass das Rechtsschutzbedürfnis mangels fortbestehender Beschwer entfällt und damit einer gerichtlichen Entscheidung in der Sache die Grundlage entzogen ist. Lediglich in besonderen Fällen kann das Rechtsschutzbedürfnis trotz einer solchen Erledigung fortbestehen. Hierunter fallen neben einer weiterhin von der aufgehobenen oder gegenstandslos gewordenen Maßnahme ausgehenden Beeinträchtigung Fälle der Wiederholungsgefahr und von tiefgreifenden und folgenschweren, sich typischerweise schnell erledigenden Grundrechtseingriffen[23]. Ein solcher Grundrechtseingriff kommt vor allem bei Anordnungen in Betracht, die das Grundgesetz vorbeugend dem Richter vorbehalten hat[24]. Hierzu zählen etwa Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen (vgl. Art. 13 Abs. 2 GG; hierzu auch BVerfGE 104, 220 <233>). Im Übrigen entfällt regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis mit Erledigung einer Maßnahme[25]. Es obliegt dann einem Beschwerdeführenden anhand der Umstände des Einzelfalls näher vorzutragen, warum etwa ein besonders belastender Grundrechtseingriff vorliegt, der trotz Erledigung ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse begründen soll[26].
Ein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis hat der Yachtbesitzer nicht anhand dieser Maßstäbe dargelegt. Mit Vollziehung der Durchsuchung hat sich diese Zwangsmaßnahme erledigt. Ein gleichwohl fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis an der verfassungsgerichtlichen Überprüfung der die Durchsuchungsanordnungen betreffenden Gerichtsentscheidungen ist weder dargelegt noch sonst erkennbar. Insbesondere hat der Yachtbesitzer nicht aufgezeigt, dass ein tiefgreifender und folgenschwerer, sich typischerweise schnell erledigender Grundrechtseingriff vorliegt. Ein solcher folgt auch nicht aus der Betroffenheit von Art. 13 Abs. 1 GG, wenn – wie hier – der Yachtbesitzer die Unverletzlichkeit der Wohnung gerade nicht substantiiert rügt[27]. Soweit der Yachtbesitzer hilfsweise eine Verletzung der Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG rügt, stehen Anordnungen, die in die genannten Grundrechte eingreifen, weder unter einem verfassungsrechtlichen Richtervorbehalt, noch erfolgt ein einzelfallbezogener Vortrag, in dessen Lichte auf einen besonders belastenden Grundrechtseingriff zu schließen sein könnte[28]. Auch inwieweit mögliche Eingriffe in die gerügten Verfahrensgrundrechte (Art. 101 Abs. 1 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 GG) einen besonders tiefgreifenden Grundrechtseingriff begründen können, ist weder dargelegt noch sonst ersichtlich.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 14. November 2023 – 1 BvR 1498/23
- BVerfG, Beschluss (GASP) 2022/337 vom 28.02.2022, ABl. L 59 vom 28.02.2022, S. 1; und Durchführungsverordnung (EU) 2022/336 vom 28.02.2022, ABl. L 58 vom 28.02.2022[↩]
- ABl. L 78 vom 17.03.2014, S. 16[↩]
- ABl. L 78 vom 17.03.2014, S. 6[↩]
- AG München, Beschluss vom 26.09.2022 – ER VII Gs 11111/22[↩]
- LG München I, Beschluss vom 08.05.2023 – 5 Qs 3/23[↩]
- LG München I, Beschluss vom 17.07.2023 – 5 Qs 3/23[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 16.10.2020 – 1 ARs 3/20, Rn. 14 ff.[↩]
- vgl. BVerfGE 78, 320 <329> 99, 84 <87> 115, 166 <179 f.>[↩]
- vgl. BVerfGE 42, 212 <219 f.> 96, 27 <40> 103, 142 <151 f.>[↩]
- vgl. BVerfGE 32, 54 <75> 89, 1 <12> 109, 279 <313 f.>[↩]
- vgl. BVerfGE 42, 212 <219> 51, 97 <110>[↩]
- vgl. BVerfGE 32, 54 <75>[↩]
- vgl. BVerfGE 51, 97 <107> 75, 318 <328> 109, 279 <313>[↩]
- vgl. insoweit BVerfG, Beschlüsse vom 27.06.2017 – 2 BvR 1562/17, Rn. 38; und vom 03.03.2021 – 2 BvR 1746/18, Rn. 50[↩]
- vgl. Kunig/Berger, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl.2021, Art. 13 Rn.20 m.w.N.[↩]
- vgl. auch BVerfG, Beschluss des Zweiten Bundesverfassungsgerichts, Beschluss vom 09.07.2009 – 2 BvR 1119/05 u.a., Rn. 28 m.w.N.; Papier, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 13 Rn. 12 (Mai 2023); Kluckert, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, Art. 13 Rn. 4 (August 2023); Krings, Der Grundrechtsberechtigte des Grundrechts aus Art. 13 GG, 2009, S. 37[↩]
- vgl. zu Diensträumen BVerfGE 103, 142 <150> vgl. zu Geschäftsräumen BVerfG, Beschlüsse vom 27.06.2018 – 2 BvR 1562/17, Rn. 39; und vom 03.03.2021 – 2 BvR 1746/18, Rn. 50[↩]
- vgl. BVerfGE 112, 50 <60> stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 129, 78 <92 f.>[↩]
- vgl. BVerfGE 112, 50 <62> 140, 229 <233 f. Rn. 10> stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 140, 229 <233 f. Rn. 10>[↩]
- vgl. BVerfGE 112, 50 <61> 140, 229 <233 f. Rn. 10>[↩]
- vgl. BVerfGE 81, 138 <140 f.> 116, 69 <79 f.> BVerfG, Beschluss vom 15.07.1998 – 2 BvR 446/98, Rn. 12; Beschluss vom 18.09.2008 – 2 BvR 683/08, Rn. 15[↩]
- vgl. BVerfGE 96, 27 <40> 104, 220 <233> BVerfG, Beschluss vom 18.09.2008 – 2 BvR 683/08, Rn. 15[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 31.01.2020 – 2 BvR 2992/14, Rn. 34[↩]
- vgl. BVerfGE 107, 299 <338> BVerfG, Beschluss vom 04.02.2005 – 2 BvR 308/04, Rn. 18 ff.; Beschluss vom 09.07.2009 – 2 BvR 1119/05 u.a., Rn. 32 m.w.N.[↩]
- vgl. dazu auch BVerfG, Beschluss vom 27.06.2018 – 2 BvR 1405/17 u.a., Rn. 59[↩]
- vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 12.07.2023 – 1 BvR 58/23, Rn. 11[↩]